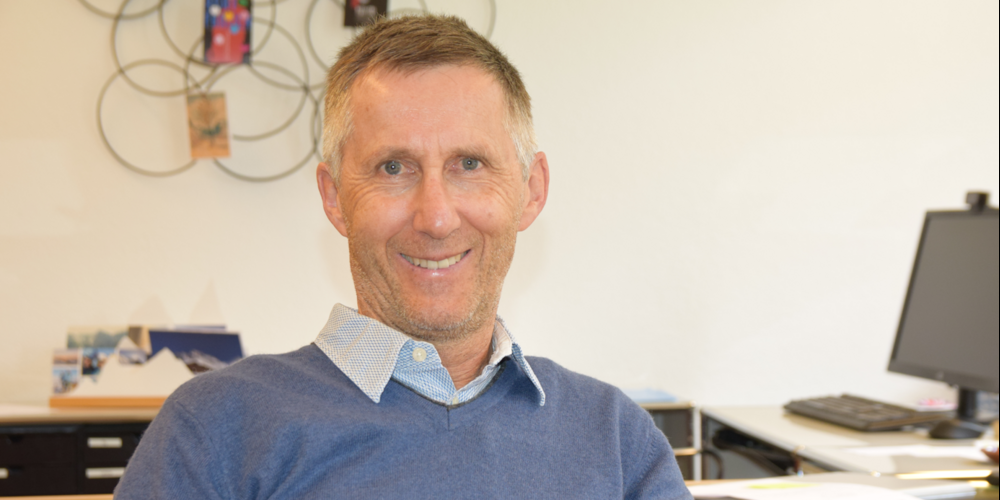Seit 48 Jahren ist Hans-Andrea Tarnutzer inzwischen an der Evangelischen Mittelschule in Schiers. Der Schierser war in dieser Zeit Schüler, Lehrer, Prorektor und seit 2018 auch als Direktor. Somit gibt es kaum einen anderen Mann, der die Entwicklung des Schierser Bildungsinstituts in den vergangenen Jahrzehnten näher miterlebt hat als er. «Ich bin nach wie vor gerne mit diesen Leuten zusammen, die hier ein- und ausgehen. Ob im Betrieb, im Lehrerzimmer oder bei Treffen mit der Schülerorganisation -ich habe noch zu allen einen guten Draht, was mir persönlich sehr wichtig ist.» Auch wenn ein beruflicher Wechsel als Alternative schon mal ein Thema gewesen sei, für eine andere Schule tätig zu werden, habe für Tarnutzer nie zur Debatte gestanden.
Nach Corona direkt zu KI
Als die Pandemie langsam dem Ende zu ging, packte Hans-Andrea Tarnutzer die Chance und nahm ein Sabbatical und reiste nach Australien. Als er wieder in Schiers zurück war, hatte sich bereits die nächste grosse Herausforderung angekündigt. Die künstliche Intelligenz eroberte die Welt im Sturm und traf die EMS wie viele andere Schulen mit voller Wucht. «Der Einstieg war wirklich ‘heavy’, da ich im November und Dezember 22 für sieben Wochen weg war.» Schon zuvor habe man oft von der künstlichen Intelligenz gesprochen, doch dies eher am Rande. «Nachdem ich zurück war, kam genau dieser Hype und allen war ChatGPT das Thema Nummer eins. Es hat uns überrascht, wie schnell und mit welcher Wucht das kommen kann. Es hat wirklich mit einem riesigen Knall eingeschlagen und man sollte von heute auf morgen sofort ein Konzept bereit haben.» Er war kaum wieder zurück in seinem Büro, als die ersten Medien schon anklopften und ihn um eine Stellungnahme zu ChatGPT baten. «Wir hatten ja auch die Geschichte mit den Smartphones vor ein paar Jahren. Die kamen aber eher schleichend. Heute geht es mit den Entwicklungen immer rasant schnell.» Am Anfang habe noch niemand so recht gewusst, wie wir das handhaben sollen, doch eins sei von Anfang an klar gewesen: Ein Verbot des Ganzen sei nie im Raum gestanden. «Unsere Schülerinnen und Schüler sind nicht dumm und sie werden uns, wie mit allem immer eine Nasenlänge voraus sein.»
Doch nur Mittelmass
Polizist spielen wollte niemand an der EMS, weshalb sie versuchten, einen Umgang mit der Thematik zu finden, wie der Direktor erklärt. «Ein ähnliches Beispiel war der Taschenrechner. Kurz vor meiner Zeit, als ich ans Gymnasium kam, wurde noch mit Rechenschiebern hantiert. Als dann der Taschenrechner kam, konnte man behaupten, dass man nun nicht einmal mehrzwei Zahlen zusammenzählen können musste. Das stimmt natürlich schon, aber zumindest auf Stufe Gymnasium muss man nicht nur Zahlen zusammenzählen, sondern auch Resultate interpretieren können.» Das vermeintlich «Einfache» falle weg, aber man müsse dann das Komplizierte genauer unter die Lupe nehmen. «Dadurch können wir schwierigere Aufgaben stellen.» Man müsse anerkennen, dass es dieses ChatGPT nun mal gebe und versuchen einen Umgang damit zu finden, was die Philosophie der EMS widerspiegle. «Man darf auch nicht vergessen, dass ChatGPT in gewissen Dingen nützlich sein kann. Man kann dort versuchen, die positiven Dinge rauszunehmen und die negativen Sachen, dass das tägliche Produzieren von Texten entfalle, auszublenden. Unsere Schülerinnen und Schüler müssen Texte interpretieren und kritisch betrachten können, da dieses Programm doch auch vor Fehlern nicht befreit ist. ChatGPT ist ja nicht intelligent, sondern ein Prozessor, der nach Wahrscheinlichkeit Texte ausspucken. Unsere Lernenden müssen mehr können. Sie oder er müssen beurteilen, ob ein Text von ChatGPT ‘verhebt’ oder nicht. Und das ist ein hoher Anspruch.» Die Gratisversion des Textprogramms sei ausserdem gar nicht so wahnsinnig toll. «Bei einem gymnasialen Anspruch bringt man es mit einem Text von ChatGPT höchstens auf Mittelmass, also maximal auf die Note 4,5. Für etwas Brillantes, gewürzt mit Emotionen, braucht es die menschliche Komponente oder auch beispielsweise persönliche Erlebnisse.» Bei den Bezahlversionen sehe es natürlich ein wenig besser aus und doch findet auch Hans-Andrea Tarnutzer, dass eine Maschine nie zu hundert Prozent literarisch schreiben werden könne.
«Fobizz» als Unterstützung
Als die Evangelische Mittelschule damit anfangen wollte dieses Hilfsmittel in den Unterricht einfliessen zu lassen, seien sie auf einen weiteren Stolperstein gestossen, nämlich der Datenschutz. «Um ein Konto bei diesem Programm zu eröffnen, braucht es eine Offenlegung der Daten, was wir rechtlich nicht von unseren Jugendlichen verlangen konnten.» Auf eine Lösung sei Tarnutzer zufällig auf der Webseite «Fobizz» gestossen, als er dort nach einer Weiterbildung für Lehrpersonen suchte. Über dieser deutschen Lernplattform könne man sich als Institution anmelden und den jungen Geistern die Möglichkeit bieten, sich anonym auszuprobieren. «Diese Webseite bietet zusätzlich ganz viele Onlineweiterbildungsmöglichkeiten zum Thema KI an. Was für uns den Vorteil hatte, dass wir nicht Experten nach Schiers kommen lassen mussten, sondern dass wir mit einer Lizenz unsere Lehrpersonen die Möglichkeit bieten konnten, online sich weiterbilden zu können. Somit konnten wir alles direkt bei uns im Haus regeln.»
Von Plagiaten zur Quelle
In der Lebensphase zwischen 12 und 18 Jahren ist es völlig natürlich, alle möglichen Dinge auszuprobieren. Darum verwundert es auch nicht, dass es an der Schule in Schiers in den vergangenen eineinhalb Jahren auch Jugendliche gegeben hat, die versucht haben, mit Hilfe von KI zu einer besseren Note zu gelangen. «Vor allem für Deutschlehrpersonen hiess es schnell, dass der ‘Heimaufsatz’ nicht mehr aufgegeben wurde, da kaum jemand über die nötigen Werkzeuge verfügt, einen von KI generierten Text von einem selbstgeschriebenen zu unterscheiden.» In diesem Bereich der Plagiatssuche sei es momentan noch schwierig, ein Fehlverhalten nachzuweisen, da ChatGPT bei der gleichen Anfrage jedes Mal ein anderes Ergebnis aus spuke. Doch es gebe in Prüfungssituationen inzwischen auch Lösungen, die sich gut eingepegelt hätten. «Bei Aufsätzen in Deutsch beispielsweise müssen sich die Jugendlichen inzwischen auf eine geschützte Ebene einloggen, auf der sie keinen Zugriff auf Internet und ChatGPT haben.» Diese digitale Quarantäne werde momentan hauptsächlich im Deutschunterricht verwendet, doch sei auch in anderen Fächern denkbar. Ein grosses Thema, wenn es ums Schreiben geht, sind sicher auch die Maturaarbeiten. Doch hier haben sich laut Tarnutzer für die Schülerinnen und Schüler mehr Türen geöffnet als geschlossen. «Sie dürfen ChatGPT nutzen, beispielsweise beim Konzept oder für die Ideensammlung. Sie müssen es einfach richtig offenlegen. Mein Sohn schreibt aktuell gerade die Masterarbeit und dort muss er unter Hilfsmittel auch ChatGPT, ein von ihm verwendetes Korrekturprogramm sowie den Kollegen, der das Ganze gegenliest, vermerken.» Wenn man es so betrachte, sei ChatGPT nichts anderes als eine grosse Bibliothek mit Wissen, die man nutzen könne. Wo man früher stundenweise in Büchern nach Quellen zur Untermalung einer These gesucht habe, passiere das nun oft in Sekundenschnelle. Dies sei überhaupt nicht verwerflich, wenn man es dann richtig deklariere, sagt der 61-Jährige.
Es bleibt anspruchsvoll
«Ausserdem darf man nicht vergessen: In der Regel sind die Maturaarbeiten eng begleitet von zwei Lehrpersonen, die dann auch Abgabefristen setzen und mit den Maturanden Fachgespräche führen. Dadurch weiss man in jedem Teilbereich, von wo die Texte sind und wie die Jugendlichen darauf gekommen sind. Wenn man zum Beispiel nur ein Kickoff- und eine Abgabe macht und dazwischen gähnende Leere herrscht, wird eine Rückverfolgung sicher um einiges schwieriger.» Doch auch für Tarnutzer ist klar, dass die neuen Hilfsmittel neben den neuen Fragestellungen auch das Bewertungssystem auf den Kopf stellen. «Die mündlichen Prüfungen werden in Zukunft definitiv mehr Gewicht bekommen, da sich dort relativ schnell zeigt, ob jemand etwas wirklich in die Tiefe verstehe oder nur so tue als ob.» Doch vor allem im Bereich der Maturaarbeiten hat der Schierser eine optimale Lösung für die Zukunft gefunden. «Ich denke, das beste Mittel gegen Plagiate ist eine enge Betreuung der Jugendlichen. Um ChatGPT die Stirn zu bieten, geht es vor allem darum, es nicht zu verteufeln, zu verbieten, aber Massnahmen zu treffen, die aufzeigen, was die Person hinter den Texten wirklich kann.» Es lohne nicht, sich dem Ganzen zu verschliessen. Sie als Schule müssten den Unterricht umkrempeln. «Zwei Texte miteinander zu vergleichen, analysierenund interpretieren sind ganz andere Aufgaben als einfach mal kurz ein Textchen zu schreiben. Wenn man Auskunft geben muss zu einem Text verlangt das nach ganz anderen Kompetenzen.» Auch wenn der grosse Rummel um das Textprogramm zwar inzwischen wieder ein wenig abgeflaut sei, beschäftige sie als Schule das Thema weiterhin, wenn auch nicht mehr täglich wie ganz am Anfang. Eine Matura zu erreichen wird jedoch auch mit ChatGPT laut Tarnutzer kein Selbstläufer. «Mit jedem Hilfsmittel, dass dir die einfache Arbeit nimmt, wird es anspruchsvoller. Dies ist aber nicht nur in der Schule, sondern auch in der Arbeitswelt so.» Denn auch wenn man Texte in Sekundenschnelle von Maschinen schreiben lassen und sie an der EMS sogar als Quelle für eine Maturaarbeit zur Hilfe ziehen kann, das Geschriebene verstehen müssen die Schülerinnen und Schüler selber. Da kann ihnen kein Roboter helfen.